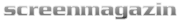Donnerstag, 8. Januar 2026
The Florida Project

Ein Herz und eine Seele: Halley und ihre Tochter Moonee
© Prokino
© Prokino
Orlando, Florida: Moonee ist erst sechs Jahre alt und hat bereits ein höllisches Temperament. Nur wenige Meilen entfernt vom Eingang zu Disneyworld wächst sie im lilafarbenen „Magic Castle Motel“ an einem vielbefahrenen Highway auf. Ihre frühreifen Streiche scheinen Halley, ihre sehr junge Mutter, kaum zu beunruhigen. Da, wie bei allen Bewohnern des Motels, ihre finanzielle Lage nicht gerade rosig ist, ist sie gezwungen, auf mehr oder weniger anständige Weise ihre wilde Tochter und sich selbst durchs Leben zu hieven. Moonee und ihre gleichaltrigen Freunde erklären derweil unter den wachsamen Augen des Motelmanagers Bobby die Welt um sich herum zu einem großen Abenteuerspielplatz...
»These are the rooms we are not supposed to go in. Well let's go anyway!« - Moonee
Nach der Odyssee einer Prostituierten, die an Heiligabend durch Tinseltown dümpelt, um nach dem Zuhälter zu suchen, der ihr das Herz gebrochen hat, Tangerine L.A., widmet sich Regisseur Sean Baker nun dem Porträt einer unterbemittelten jungen Mutter, die mit ihrer Tochter in einem Motel lebt. Der Regisseur beschreibt seinen Film am liebsten als eine moderne Version der „kleinen Strolche“: »In diesen komödiantischen Kurzfilmen, die Hal Roach in den 20er und 30er Jahren produzierte, ging es um Kinder, die während der Großen Depression in einer prekären Situation aufwachsen. Ihre ökonomische Situation war die Kulisse für die Filme - im Mittelpunkt standen aber die aberwitzigen und urkomischen Abenteuer, die die Kinder erlebten.«
Nun, ganz so lustig sind die Abenteuer hier nicht, sind doch die Möglichkeiten, Quatsch zu machen doch etwas begrenzter als in einer Großstadt. Der Film besitzt auch einen eher realen Touch - die Kamera ist steht ruhig und oft in der Ferne, als wenn man als Zuschauer immer irgendwie am Geschehen ist, aber nie so nah dran, dass man entdeckt wird, als wenn man als Unsichtbarer Mäuschen spielt.
Dass die Figuren so echt wirken, hat Sean Baker seiner unkonventionellen Besetzungsfindung zu verdanken. Wie schon im Falle seines letzten Films, wo er seine Besetzung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Vine gefunden hatte, wurde er auch dieses Mal wieder in den sozialen Netzwerken fündig. Auf Instagram stieß er auf das Profil von Bria Vinaite.
»Bria hatte etwas ganz Besonderes an sich, das sie unter den tausenden anderen Instagrammern hervorstechen ließ«, sagt der Filmemacher. »Sie nahm sich selbst nicht so super ernst. Bria kommt etwas überdreht, sorglos und extrem lustig rüber - lauter Eigenschaften, die ich auch ihrer Rolle Halley zuschreibe. Ich wollte Halley in The Florida Project nicht zum Opfer stilisieren, sondern sie als liebevolle Mutter darstellen, die im Grunde ihres Herzens selbst noch ein Kind ist.«
»Oh my god, this is unacceptable! I've failed as a mother, Moonee! You disgraced me, haha!« - Halley
Neben den Strolch-Aktivitäten der Kinder, sieht man auch immer wieder, wie Halley mit ihrer Tochter in den Disney-Hotels das Frühstücksbuffet erschwindelt, Billigparfüm an die Hotelgäste und geklaute Parkarmbänder verkauft. Dass dies kein Vorbild sein kann, steht außer Frage. Der Grund dafür ist jedoch einfach: Halley bekommt keinen Job, hauptsächlich wegen ihres Verhaltens, das mit ihrem Äußerlichen einhergeht - türkisfarbene Haare, überall Tätowierungen und Metall im Gesicht. Also muss sie das Geld fürs Motelzimmer irgendwie beschaffen.
Als sie sich dann noch mit ihrer Freundin entzweit, die Halley und Moonee stets mit Resten aus der Küche des Diners versorgt hat, scheint sich die soziale Situation zu verschlechtern. Nachdem sie Freier für Geld mit aufs Zimmer bringt, während Moonee in der Badewanne sich ihre Barbiepuppen badet, wird sogar das Jugendamt eingeschaltet, das letztlich Moonee von der Mutter trennen will. Am Ende sehen wir, dass sich Moonee von den Bearbeiterinnen losreißt und mit ihrer Freundin Jancey Disneyland erstürmt.
»Kurz vor Drehstart sah ich eine Mutter mit ihrer Tochter, die genauso aussahen und sich benahmen, wie sich Chris und ich Halley und Moonee vorgestellt hatten«, reüssiert Sean Baker. »Die beiden Rollen sind eigentlich die Summe vieler verschiedener Menschen, die wir kennengelernt hatten. Aber dann war ich in diesem Supermarkt und habe dieser Mutter und ihrer Tochter eine Weile zugesehen, wie sie dort mit dem Einkaufswagen herumgefahren sind – ähnlich wie Halley und Moonee nachher im Film. Ich sprach die beiden an und alles, was sie mir über ihr Leben erzählten, entsprach hundertprozentig dem, was Chris und ich uns für den Film ausgedacht hatten. Das war schockierend.«
Es passiert nicht wirklich viel in diesem doch recht langatmigen Film mit seinen ruhigen, dennoch ausgezeichneten Bildern. Man bekommt nicht wirklich Mitleid für die Mutter, doch für Moonee und vor allem dem Motelmanager Bobby, den Willem Dafoe bravourös darstellt: »Ich hatte das Glück, vor dem Dreh mit einigen Motelmanagern über ihre Arbeit zu sprechen und sie dabei beobachten zu können«, so der Schauspieler, der übrigens neben Caleb Landry Jones als dessen Gehilfe die einzigen professionellen Schauspieler am Set waren. »Sie sind sehr stolz auf das, was sie tun, obwohl sie einen harten Job haben. Für manch einen mag ihr Optimismus, mit dem sie die Welt durch ihr Engagement im Motel zu einem besseren Ort machen wollen, seltsam anmuten. Aber diese Manager geben wirklich alles dafür, die Umgebung, in der sie arbeiten, schöner und wohnlicher zu machen. Ich war sehr beeindruckt von ihrer Menschlichkeit und von ihrem Willen, etwas zu verändern – auch wenn ihnen dafür wenige Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stehen.«
The Florida Project zeichnet nicht nur eine Momentaufnahme im Leben dieser Menschen, sondern hält uns auch den Gesellschaftsspielgel vor die Nase, vor allem denjenigen, die nicht wissen, dass es solche Menschen gibt. Wer schon mal in Florida war, kann sich in diese Schicksale und Lokalitäten hineinversetzen. Der Film ist einfach für diejenigen, die sich nicht vorstellen können, dass es so etwas am Rande des Glanzes Amerikas überhaupt gibt. Doch trotz der deprimierenden Realität, die dieser Film aufzeigt, ist er doch als Spielfilm nicht wirklich packend. Und als es endlich spannend wird, ist der Film zuende. Er beginnt mit Kool & The Gangs „Celebration“, das nach den Vorspanntafeln abrupt endet, doch der Rest des Films schwingt nicht auf dieser bewegenden musikalischen Welle weiter und setzt Musik nur sporadisch ein, zumeist im Hintergrund der jeweiligen Lokalität. Da hätte mehr Stimmung drin sein können, doch so kann man sich auch in ein solches Motel einmieten und dem Ambiente zusehen und die Sonnenuntergänge bewundern, wie Bobby im Film - da hat man dasselbe. ■ mz
10. März 2018
 Drama
Drama